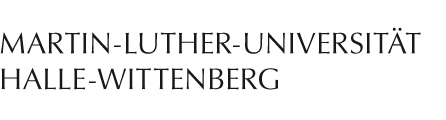Hallesche Abendgespräche im Wintersemester 2025/26
(De-)Thematisierung von Ost | West Differenzverhältnissen in der erziehungswissenschaftlichen Forschung?
Organisation: Jessica Dalljo & Dr. Marian Laubner
Die Erfahrungen der deutschen Teilung und Wiedervereinigung wirken bis heute auf Bildungssysteme, soziale Strukturen und gesellschaftliche Werte ein. Während in den Jahrennach der Wende die Transformation ostdeutscher Schulen und professionsbezogene Fragen im Fokus standen, geriet die Ost|West-Differenz in der erziehungswissenschaftlichen Forschungzunehmend aus dem Blick. In den Sozialwissenschaften hingegen erfährt das Thema aktuelleine neue Konjunktur – nicht zuletzt durch gesellschaftspolitische Entwicklungen und jüngste Publikationen.
Ausgehend davon lädt die Veranstaltungsreihe der Halleschen Abendgespräche des Zentrums für Schul- und Bildungsforschung dazu ein, die Notwendigkeit und Implikationen einer (De)Thematisierung von Ost|West-Differenzen in der Erziehungswissenschaft zu diskutieren.
Wie sollte die Erziehungswissenschaft auf die aktuellen Entwicklungen reagieren? Welche Risiken birgt eine einseitige Fokussierung auf Ost|West-Differenzen, und welche Potenzialeergeben sich? Ziel ist es, Raum für eine neue Reflexion zu öffnen – rückblickend, gegenwärtigund mit Blick auf zukünftige Entwicklungen.
| Zeit | 18.00 Uhr (c.t.) |
| Ort | Zentrum für Schul- und Bildungsforschung (ZSB), Philosophische Fakultät III, Haus 31, Untergeschoss (im Eingangsbereich gerade aus) |
20.10.2025
Bildungshistorische Forschung zur deutschen Bildungsgeschichte nach 1945.
Ost | West-Differenzverhältnisse in der Erziehungswissenschaft
Sabine Reh: Humboldt-Universität zu Berlin
In ihrem Vortrag wird die Bildungshistorikerin Sabine Reh ein Thema aufgreifen, dass gegenwärtig die Gemüter bewegt: Ist der Westen anders als der Osten Deutschlands oder der Osten anders als der Westen? Haben die Menschen hier andere Erfahrungen als dort gemacht? Entstehen Wahrnehmungen des Ostens und des Westens jeweils auch im wissenschaftlichen Sprechen darüber, in Adressierungen und Unterstellungen, wie sie hier vorgenommen werden? Die Vortragende geht aus von Ergebnissen eines gerade auslaufenden, großen Forschungsverbundes zur Bildungsgeschichte der DDR. Untersucht wurden hier Bildungsmythen einer untergegangenen Diktatur, die auch nach dem Ende der DDR noch virulent sind - und damals wie vielleicht erst recht heute zu Widersprüchen einladen und zu Auseinandersetzungen herausfordern. Identifiziert wurden verschiedene Narrative und Bilder, denen eine große Bedeutung und teilweise auch ein hoher identifikatorischer Stellenwert zukam. Sie haben eine mythisierende Kraft, sie weisen oft über die DDR hinausgehende Traditionen auf und stellen eine Art von Verbindungsglied in einer längeren deutschen Bildungsgeschichte dar - und gleichwohl können sie Besonderheiten der DDR sichtbar machen. Zu solchen mythisierenden Elementen, die ihre Wirksamkeit auf unterschiedlichen Ebenen entfalten, zählen etwa die Idee einer „Bildung für alle“, die der „Wissenschaftlichkeit des Unterrichts“, Vorstellungen über Geschlechtergerechtigkeit oder das Bild einer „schönen Kindheit“. An einem kleinen Beispiel, dem der Vorstellung von „Schöpfertum“ und von einem „schöpferischen“ Individuum, wird in diesem Vortrag gezeigt, wie in der DDR ein ganz eigenes Narrativ von der „schöpferischen Tätigkeit“ entstand - dem die Realität nicht entsprach und das widersprüchliche Bezüge zum Kreativitätsdispositiv (Reckwitz) besitzt, das sich seit den 80/90er Jahren in Deutschland herausgebildet hat. Sichtbar wird, wie, mit welchen Fragen und Instrumenten - und auch: mit welchen epistemologischen Vorkehrungen - eine deutsche Bildungsgeschichte für die Zeit nach 1945 betrieben werden kann, die die DDR weder isoliert betrachtet, sie als Besonderes nicht perhorresziert, aber auch nicht „verharmlost“, noch als Fuẞnote erscheinen lässt. Vielmehr versteht sie diese als Bestandteil einer gesamtdeutschen Geschichte von Erziehung und Bildung nach 1945.
17.11.2025
Ost-West-Differenz als interkultureller Prozess
Ingrid Miethe: Justus-Liebig-Universität Gießen
15.12.2025
Ost-West-Differenzen - ein Dialog
Kerstin Jergus: Universität Hamburg
Olaf Sanders: Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg
In einem Dialog zwischen Prof. Dr. Olaf Sanders (HSU) und Prof. Dr. Kerstin Jergus (Uni Hamburg) werden die jeweiligen wissenschaftlichen, biographischen und regionalen Positioniertheiten im Pendeln zwischen Ost-West zum Hintergrund genommen, um gemeinsam die erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Ost-West-Thematik zu diskutieren. Uns geht es dabei sowohl um befremdende Blicke auf die jeweiligen Auseinandersetzungsformen, in denen wir als Erziehungswissenschaftler:innen mit der Ost-West-Differenz in Berührung kommen als auch um die darin möglichen Verbindungspunkte in der differenten Ost-West-Positionierung.
19.01.2026
„This shifts the question from how to achieve equality to how to avoid the erasure of what is different“ - Amoderne Einsichten und Anregungen zur De-/Thematisierung von West-Ost-(Rest-) Differenzen
Sandra Matthäus: Georg-August-Universität Göttingen
Der Vortrag entfaltet die zweigeteilte These, dass 1) das Gros der bisherigen Ostdeutschlandforschung so ungebrochen, wie es in Bezug auf kaum ein anderes Thema der Sozialwissenschaften noch denkbar ist, dem modern(isierungstheoretisch)en Paradigma folgt und dies in seinen sozial- und gesellschaftstheoretischen Grundlagen auch da noch, wo dies vermeintlich zurückgewiesen wird, was – wie exemplarische Analysen einschlägiger Studien aufzeigen werden – die erheblichen methodologischen Probleme verdeutlicht und erklärt, die in Bezug auf die Wissens- und Wahrheitsproduktion über »den Osten» (und damit impliziterweise auch über »den Westen«) zu konstatieren sind; und dass 2) diese Probleme durch einen Rückgriff auf „amoderne“ (Bruno Latour) Theorien und Methodologien vermieden werden können, wie dies etwa postkoloniale oder postmigrantische Ansätze, insbesondere aber Arbeiten demonstrieren, die den methodologischen Prinzipien des „ontological turn“ folgen – einer Denkbewegung, die sich an der Intersektion von Science an Technology Studies, Environmental Humanities und Decolonial Studies herausgebildet hat und die insbesondere eine adäquatere Verhandlung von Einheit und Differenz, Identität und Alterität ermöglicht. Der Vortrag plädiert somit auch dafür, in Zukunft verstärkt auf derartige Prinzipien zurückzugreifen und dies nicht nur um das ›West‹-›Ost‹-, sondern in Anlehnung an Stuart Hall auch das ›West‹-, ›Ost‹-, ›Rest‹-Verhältnis und damit verbunden auch das ›Mensch‹-›Natur‹-Verhältnis weniger (epistemisch) gewaltvoll gestalten und derart konstruktiv(er) den Herausforderungen unserer Zeit begegnen zu können.